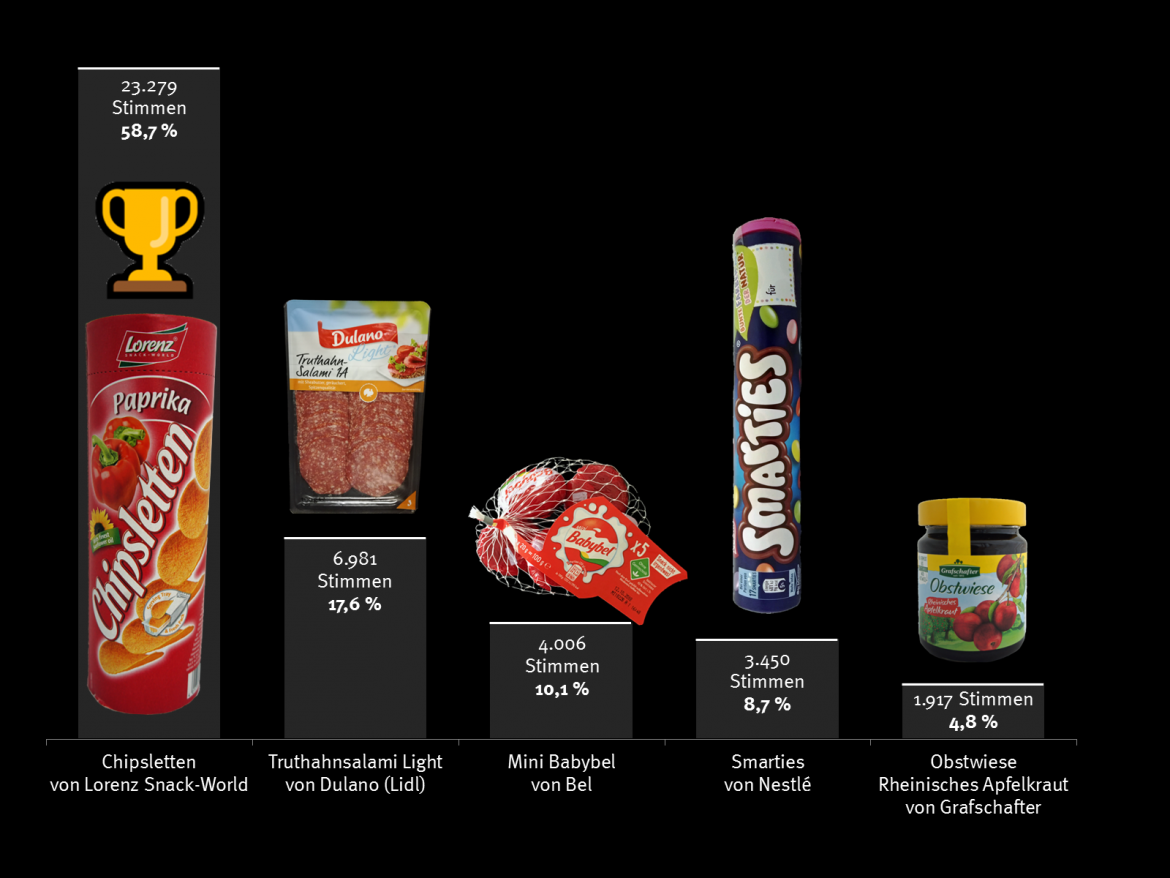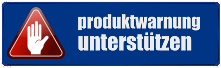In eigener Sache – Kritik an vielen Online-Medien
Immer wieder tauchen über Google News „alte“ Rückrufe mit neuem bzw. „aktualisiert am“ Datum auf. Es sind meist die gleichen Onlineausgaben einiger Zeitungsverlage, die sich hier offenbar mit den dazugehörigen reißerischen Titeln auf Klickgenerierung spezialisiert haben.
 Auf diese Art und Weise wird große Verunsicherung bei Verbraucherinnen und Verbrauchern gestreut. Ich erhalte immer wieder viele Nachrichten, Hinweise, Anfragen und Anrufe. Oftmals ist für Leserinnen und Leser kaum erkennbar (weil das Veröffentlichungsdatum fehlt), dass es sich um eine „alte“ Meldung handelt, die plötzlich als „aktuelle Neuigkeit“ über die Suchmaschine daherkommt, oder ob es ja vielleicht schon wieder passiert ist.
Auf diese Art und Weise wird große Verunsicherung bei Verbraucherinnen und Verbrauchern gestreut. Ich erhalte immer wieder viele Nachrichten, Hinweise, Anfragen und Anrufe. Oftmals ist für Leserinnen und Leser kaum erkennbar (weil das Veröffentlichungsdatum fehlt), dass es sich um eine „alte“ Meldung handelt, die plötzlich als „aktuelle Neuigkeit“ über die Suchmaschine daherkommt, oder ob es ja vielleicht schon wieder passiert ist.
Es sind oft schon einige Wochen alte Meldungen, die auf diese Weise immer und immer wieder gepuscht werden. Dieses Vorgehen deckt sich nicht mit meinem Verständnis von objektiver und seriöser Berichterstattung. Unter dem Mäntelchen Verbraucherschutz wird versucht, über die zwischen Werbebannern und Videos versteckten Meldungen, soviel als möglich an Werbeeinnahmen zu erzielen, denn mit jedem Seitenaufruf, mit jeder Einblendung von Werbebannern werden Einnahmen generiert.
„Liebe VerlegerInnen, liebe RedakteurInnen:
Ich hoffe inständigst, dass das neue Leistungsschutzrecht nicht einen einzigen Cent an Einnahmen einbringt! Ich hoffe aber auch, dass ihr auch konsequent bleibt, wenn die großen News Aggregatoren Euch deshalb rausschmeißen!“
Ich kann allen, die sich im Netz informieren, nur anraten, lassen Sie sich nicht als Einnahmequelle missbrauchen. Installieren Sie sich Werbeblocker! Oder besser noch, meiden Sie derlei Onlineangebote einfach!
Übrigens, Sie können sich auch beim Deutschen Presserat beschweren
Leistungsschutzrecht
Unter www.leistungsschutzrecht.info gibt es eine neue Plattform, die über das von den Presseverlagen geforderte Leistungsschutzrecht für Presseverlage informiert. Sie wird von der „Initiative gegen ein Leistungsschutzrecht” (IGEL) betrieben. Die Webseite informiert umfassend über das Thema, sammelt Materialien und Artikel und gibt einen Überblick über die wichtigsten Argumente pro und contra Leistungsschutzrecht.
Die Initiative wird unterstützt von einer Vielzahl von Blogs, Informationsportalen, Initiativen und Unternehmen. Jeder kann seine Meinung sagen und weitere Unterstützer werden gesucht. IGEL, die Initiative gegen ein Leistungsschutzrecht, lädt Euch herzlich ein, mitzumachen!