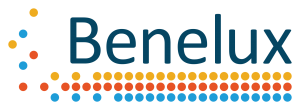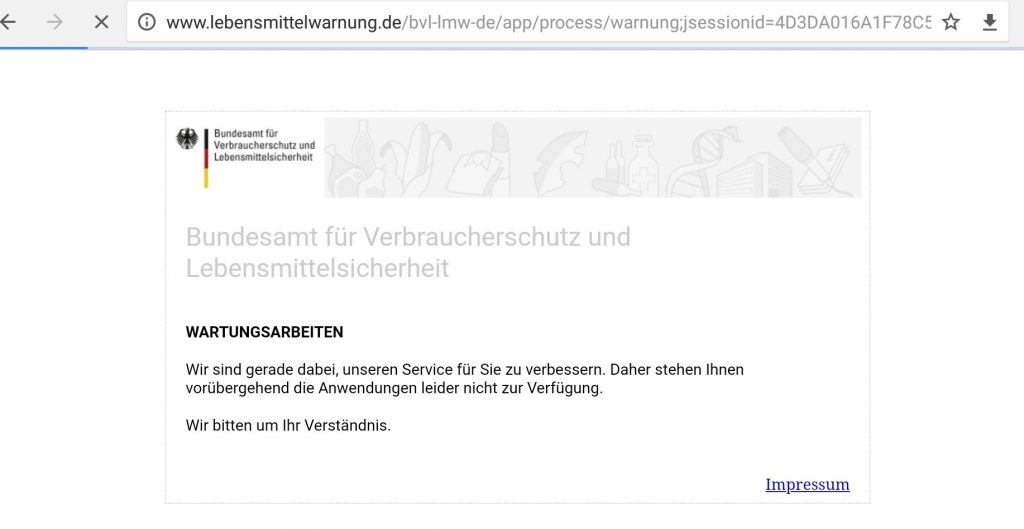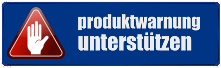foodwatch-Report: Rückrufe von gesundheitsgefährdenden Lebensmitteln kommen oft zu spät oder gar nicht – foodwatch kritisiert mangelhaftes Warnsystem
Wichtige Lebensmittelwarnungen kommen bei den Verbrauchern oft nicht an. In etlichen Fällen entscheiden sich Unternehmen und Behörden zu spät, manchmal auch gar nicht für eine erforderliche Rückrufaktion und die Information der Öffentlichkeit. Zudem werden dabei die gesundheitlichen Risiken der Lebensmittel, die zum Beispiel mit Bakterien belastet sind oder Fremdkörper enthalten, immer wieder verharmlost. Zu diesen Ergebnissen kommt der Report „Um Rückruf wird gebeten“, den foodwatch an diesem Donnerstag in Berlin vorstellte. Darin kritisiert die Verbraucherorganisation auch das staatliche Internetportal lebensmittelwarnung.de als gescheitert. Eine Auswertung von allen 92 Rückrufaktionen, die dort in zwei Testzeiträumen über insgesamt zwölf Monate hinweg veröffentlicht wurden, ergab: Die verantwortlichen Behörden stellen fast jede zweite Warnung (47 Prozent) verspätet auf die Seite. Die betroffenen Lebensmittelunternehmen nutzen praktisch nie alle verfügbaren Kommunikationskanäle, um vor unsicheren Produkten zu warnen.
„Hersteller rufen heute viel häufiger ihre Produkte zurück als noch vor ein paar Jahren – dennoch können die Verbraucherinnen und Verbraucher nicht sicher sein, dass im Fall der Fälle wirklich ein Rückruf gestartet wird und vor allem, dass sie davon auch erfahren“, sagte foodwatch-Deutschland-Geschäftsführer Martin Rücker. „Der Handel spielt eine besonders wichtige Rolle bei der Information von Kundinnen und Kunden über unsichere Lebensmittel. Es wird höchste Zeit, dass Supermärkte an zentraler Stelle über alle Rückrufaktionen aus ihrem Sortiment informieren – dazu sind sie bisher nicht verpflichtet, und die wenigsten Handelsunternehmen leisten hier ihren Beitrag.“ Mit einer heute unter warn-mich.foodwatch.de gestarteten E-Mail-Aktion forderte foodwatch die großen Handelsketten auf, in Zukunft mit Aushängen in den Märkten, mit Newslettern und in Social-Media-Kanälen über Lebensmittelwarnungen zu informieren.
Lena Blanken, Expertin für Lebensmittelhandel bei foodwatch, erklärte: „An allen Ecken fehlt es an Klarheit: Das Lebensmittelrecht lässt zu viele Spielräume, wann ein Rückruf erforderlich ist. Den Behörden sind oftmals die Hände gebunden, weil sowohl die Risikoeinschätzung als auch die öffentliche Warnung in erster Linie Aufgabe der Unternehmen ist, die hier einen unauflösbaren Interessenkonflikt haben. Nicht zuletzt geht fast jede Behörde gegenüber den Unternehmen anders vor, weil es an Standards fehlt.“ So gebe es keinen Katalog, auf welchem Weg eine Warnung verbreitet werden muss – die Behörden verlangten oft nur den Versand einer Pressemitteilung an eine Nachrichtenagentur. Newsletter, Facebook-Seiten oder zentrale Aushangflächen im Einzelhandel blieben vielfach ungenutzt.
Ganz so neu ist diese Erkenntnis jedoch nicht. Schon zum Start des Portals im Jahr 2011 hatte die Linken-Abgeordnete Karin Binder den Mehrwert der Internetseite bei „nahe Null“ gesehen und zweifelte schon damals daran, dass Lebensmittelwarnungen tatsächlich beim Endverbraucher ankommen.
Auch wir hatten 2016 genau diese Thematik aufgegriffen und sind zum Schluß gekommen, Lebensmittelwarnungen – Behörden warnen unzuverlässig und unzulänglich
2011 hatten Bund und Länder die Internetseite lebensmittelwarnung.de als zentrale Informationsplattform gestartet – ein Anspruch, den das Portal nach Auffassung von foodwatch nicht erfüllt. So investierten die Betreiber kaum in die Steigerung der Bekanntheit der Seite. Bereits zum Auftakt vor sechs Jahren verabredeten sie in einer foodwatch vorliegenden Bund-Länder-Vereinbarung die Einrichtung eines E-Mail-Newsletters zur Information der Bürgerinnen und Bürger. Dieser ist bis heute nicht umgesetzt. Hinzu komme die oftmals unnötig späte Einstellung von Rückrufaktionen auf die Seite. Das habe auch jüngst die mangelnde Informationspraxis der Behörden beim Skandal um Fipronil-belastete Eier gezeigt. Beispiele aus der Auswertung von foodwatch:
– Eine Warnung vor potenziell listerienbelasteten Pilzen erschien erst drei Tage nach der Herstellerwarnung auf der staatlichen Internetseite – weil dazwischen Silvester und der Neujahrstag lagen und die zuständige Behörden an Feiertagen wie an Wochenenden grundsätzlich keine Informationen auf lebensmittelwarnung.de einstellt.
– Erst vier Tage nach dem Rückruf eines Bio-Säuglingstees durch den Hersteller erfuhren davon die Leser von lebensmittelwarnung.de – weil die örtlich für diese Firma zuständige Überwachungsbehörde zwei Tage benötigte, um die Information an ihre obere Landesbehörde weiterzureichen, die wiederum als einzige für die Einstellung von Meldungen aus ihrem Bundesland in das Portal zuständig ist. Dafür benötigte sie aufgrund von weiteren „Ermittlungen“ abermals zwei Tage.
– Bei einem Nahrungsergänzungsmittel, das nicht zugelassene pharmakologische Substanzen enthielt und dessen Konsum in selten Fällen zu Herzinfarkten oder Schlaganfällen führen konnte, vergingen sogar 20 Tage, bis die zuständige Behörde warnte. Sie begründete den Verzug mit der Notwendigkeit, den niederländischen Hersteller zunächst anzuhören. Dieser war jedoch nicht erreichbar.
Zudem stehen mangelhafte Regelungen im deutschen und europäischen Lebensmittelrecht dem Verbraucherschutz im Wege – schon bei der Frage, ob es überhaupt zu einem Rückruf kommt. Selbst eine bekannte Grenzwertüberschreitung löst demnach nicht zwingend eine Rückrufaktion aus.
Bei der öffentlichen Information kommt es den foodwatch-Recherchen zufolge immer wieder zum Rechtsbruch, teilweise mit Wissen der Behörden: Sobald ein unsicheres Lebensmittel die Verbraucherinnen und Verbraucher bereits erreicht haben könnte, darf der Hersteller nach dem Lebensmittelrecht das Produkt nicht nur „still“ zurückrufen, also aus den Lagern räumen – er muss öffentlich über die Rücknahme informieren. Mehrere Gesprächspartner aus Behörden und Industriekreisen bestätigten foodwatch, dass diese öffentliche Information nicht immer erfolge.
In ihrem Report berichtet die Verbraucherorganisation auch von vorbildlichen Rückrufaktionen, bei denen Hersteller alles unternahmen, um die Öffentlichkeit über alle verfügbaren Kanäle zu warnen. Eine solch offensive Informationspolitik sei jedoch die Ausnahme. Da das Lebensmittelrecht zahlreiche Interpretations- und Ermessensspielräume sowie undefinierte Rechtsbegriffe enthalte, seien Verbraucherinnen und Verbraucher vom guten Willen und der Sachkompetenz der Unternehmen und Behörden abhängig. Die Unternehmen haben nach dem Willen des Lebensmittelrechts die prioritäre Verantwortung für die Risikoeinschätzung und Warnung der Öffentlichkeit und müssen daher einen kaum aufzulösenden Interessenkonflikt austragen. Sie müssen zwischen wirtschaftlichen Interessen und Reputation auf der einen und einer offensiven Informationspolitik auf der anderen Seite abwägen.
Link:
E-Mail-Aktion an Handelsunternehmen: warn-mich.foodwatch.de
Quelle: foodwatch e.V.
Internet: www.foodwatch.de