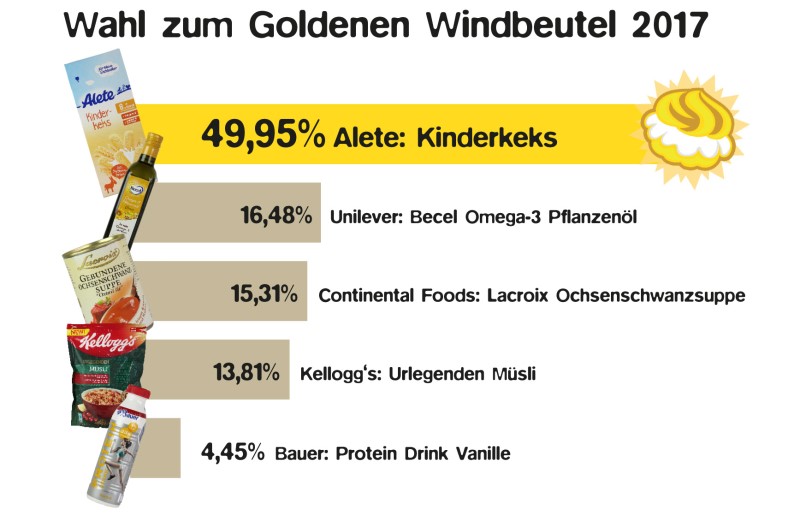foodwatch-Labortest: Baby-Lebensmittel aus Reis mit krebserregendem Arsen belastet
foodwatch hat 18 Reisprodukte für Babys von Alnatura, Bebivita, dm, Hipp, Holle, Rossmann und Sunval getestet – Alle getesteten Baby-Lebensmittel enthalten anorganisches Arsen, es gibt jedoch deutliche Unterschiede in der Höhe der Belastung – foodwatch fordert Hersteller auf, Belastung zu minimieren
Die Verbraucherorganisation foodwatch hat bei einem Labortest von Reisflocken und Reiswaffeln für Babys in allen untersuchten Proben krebserregendes Arsen nachgewiesen. Einige Produkte waren dabei deutlich stärker belastet als andere: So enthielt eine Probe des „Bio-Babybrei Reisflocken“ des Herstellers Holle fast viermal so viel Arsen wie der „Sun Baby Bio Reisbrei“ von Sunval. Die „Hipp Apfel Reiswaffeln“ waren fast dreimal so stark belastet wie die „Reiswaffeln Apfel-Mango“ der Hipp-Tochterfirma Bebivita. Zwar lässt sich bei Reis eine Arsenbelastung nicht gänzlich vermeiden, die deutlichen Unterschiede zeigen jedoch laut foodwatch: Die Hersteller haben es in der Hand, die Belastung zu minimieren.
„Babys und Kleinkinder müssen vor krebserregenden Stoffen wie anorganischem Arsen bestmöglich geschützt werden. Die Hersteller von Babynahrung sind in der Verantwortung, die Belastung mit Arsen auf ein unvermeidbares Minimum zu reduzieren. Es ist inakzeptabel, dass einige Produkte drei- bis viermal so viel Arsen enthalten wie andere“, kritisierte Johannes Heeg von foodwatch.
foodwatch hat insgesamt 18 Baby-Lebensmittel aus Reis untersuchen lassen: fünf Reisflocken-Produkte zur Zubereitung von Säuglingsbrei und 13 Reiswaffeln, die für Babys „ab dem 8. Monat“ vermarktet werden. In allen untersuchten Proben fand sich anorganisches Arsen. Laut Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR) gibt es für anorganisches Arsen keine sicheren Aufnahmemengen. Der Stoff ist krebserregend. Eine chronische Aufnahme kann zu Hautveränderungen und Nervenschäden führen. Da Arsen sich in Reis nicht vollständig vermeiden lässt, vertritt das Institut die Auffassung, dass die Hersteller die Belastung so niedrig wie möglich halten sollen. Eltern empfiehlt das BfR, Lebensmittel aus Reis wie Reiswaffeln oder Reisbrei nur in Maßen zu füttern und mit reisfreien Produkten abzuwechseln. foodwatch forderte die Hersteller auf, auf der Verpackung über die Verzehrempfehlung des BfR zu informieren.
Die Europäische Union schreibt Grenzwerte für anorganisches Arsen in Reis und bestimmten Reisprodukten vor. Reis, der als Zutat für Babynahrung verwendet wird, darf maximal 0,1 Milligramm anorganisches Arsen pro Kilogramm enthalten. Die von foodwatch untersuchten Produkte waren zum Teil höher belastet. foodwatch hat die Analyseergebnisse an die zuständigen Behörden für Lebensmittelüberwachung weitergeleitet. Diese müssten nun prüfen, ob die Reisprodukte verkehrsfähig sind, so foodwatch. Zudem forderte die Verbraucherorganisation die Behörden auf, Babyprodukte auf Reisbasis regelmäßig auf ihren Arsengehalt zu untersuchen und die Ergebnisse umgehend zu veröffentlichen.
Professor Andrew Meharg vom Institut für Globale Lebensmittelsicherheit an der Queen‘s Universität Belfast hat den Test im Auftrag von foodwatch durchgeführt. Die untersuchten Proben der Reisflocken und Reiswaffeln enthielten pro Kilogramm zwischen 0,028 und 0,111 Milligramm anorganisches Arsen. Damit lagen sie im Durchschnitt deutlich über den Gehalten, die bei einer aktuellen Analyse von Baby-Reisprodukten aus Großbritannien gemessen wurden: „Baby-Lebensmittel aus Reis stellen in Deutschland eine unnötige Gesundheitsgefahr dar“, kritisierte Professor Andrew Meharg. „Niedrige Werte sind machbar: Auf dem britischen Markt weisen Baby-Reisprodukte nur sehr geringe Belastungen mit Arsen auf. Es gibt keinen Grund, warum deutsche Hersteller nicht in der Lage sein sollten, ebenso niedrige Werte zu erreichen.“
Arsen ist von Natur aus in der Erdkruste vorhanden. Über das Grundwasser kann Arsen ins Trinkwasser gelangen und von Pflanzen aufgenommen werden. Reis nimmt besonders viel Arsen auf.
PDF – Alle Testergebnisse im Detail > BfR zu Arsen in Reis >
Quelle und Produktabbildungen: foodwatch e.V.
Internet: www.foodwatch.de