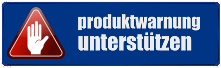Gefährliche Keime, gegen die viele Antibiotika nicht mehr wirken, finden sich in Deutschland in Bächen, Flüssen und Badeseen. Das zeigen Wasser- und Sedimentproben, die der NDR exemplarisch an zwölf verschiedenen Orten in Niedersachsen genommen hat. „Das ist wirklich alarmierend“, sagt der Antibiotika-Experte Dr. Tim Eckmanns vom Robert-Koch-Institut zu den Funden. „Die Erreger sind anscheinend in der Umwelt angekommen und das in einem Ausmaß, das mich überrascht.“

Klar war zwar bislang, dass Antibiotika-resistente Erreger in der Umwelt zu finden sind und sich dort ausbreiten können. Wie stark Gewässer belastet sind, ist allerdings weitgehend unbekannt, da es bislang keine systematischen Kontrollen auf solche Erreger gibt.
Die Proben, die der NDR genommen hat, wurden von renommierten Wissenschaftlern der Technischen Universität Dresden und des Deutschen Zentrums für Infektionsforschung am Universitätsklinikum Gießen untersucht. Von den Ergebnissen zeigten auch sie sich überrascht. Sie wiesen in den Proben von allen Orten multiresistente Erreger nach – und auch Resistenzen gegen wichtige Reserve-Antibiotika. Der Gewässerforscher Prof. Thomas Berendonk von der Technischen Universität Dresden sagte in einem Interview für die NDR Sendung „Panorama – die Reporter“, die Funde bereiteten ihm Sorge. Wenn ein Mensch mit einem solchen Bakterium kolonisiert sei, könne dies ein Problem sein.
Bei den gefundenen Keimen handelt es sich um sogenannte multiresistente gram-negative Bakterien (MRGN). Sie bereiten Ärzten seit einigen Jahren größere Sorgen als die bekannten MRSA-Erreger. Denn sie können zu schwerwiegenden Erkrankungen führen, die schwer zu behandeln sind. Und die Zahl der Infektionen durch solche Erreger steigt. Besonders gefährdet sind vorerkrankte Menschen, aber auch Ältere und Neugeborene.
Immer mehr Patienten, die zu ihnen in die Klinik kämen, würden solche multiresistenten Erreger in sich tragen, schon bevor sie aufgenommen würden, sagt Prof. Trinad Chakraborty vom Gießener Universitätsklinikum. „Es gibt eine Quelle für Resistenzen außerhalb der Klinik, und das ist ein Problem, das uns zunehmend interessiert.“
Dass multiresistente Keime in der Umwelt grundsätzlich ein Risiko darstellen, ist unumstritten. „Die Gefahr ist, dass sie sich ausbreiten und es dann auf den Menschen zurückschlägt“, sagt Tim Eckmanns vom Robert-Koch-Institut.
Der NDR hat auch an zwei Badestränden Proben genommen – an der Thülsfelder Talsperre und am Zwischenahner Meer. Dort fanden sich ebenfalls multiresistente Erreger. Unklar ist aber, wie hoch mögliche Gesundheitsgefahren für Badende sind. Bei gesunden Menschen führen solche Erreger in der Regel nicht zu einer Infektion. Bei einer offenen Wunde oder einer eventuell nötigen Operation können sie aber zum Problem werden. Es besteht zudem das Risiko, dass die Bakterien beispielsweise in Kliniken oder Pflegeheime weitergetragen werden.
In den Proben aus Niedersachsen seien einige Keime dabei gewesen, die ihm größere Sorgen bereiten würden, sagt der Mediziner Dr. Can Imirzalioglu vom Universitätsklinikum Gießen. „Wir haben Erreger gefunden, die bei bestimmten Patienten durchaus schwerwiegende Infektionen verursachen können und auch schon als sehr virulente, also sehr gefährliche Erreger beschrieben worden sind.“ Das habe er so nicht erwartet.
Besonders kritisch sehen die Wissenschaftler Funde des sogenannten mcr-1-Gens an fünf der zwölf Probenorte. Bakterien, die solch ein Gen in sich tragen, sind resistent gegen das besonders wichtige Reserve-Antibiotikum Colistin. Das Notfallmedikament wird nur in lebensbedrohlichen Situationen eingesetzt, wenn alle anderen Antibiotika versagen.
Wissenschaftler halten es für wahrscheinlich, dass das Resistenzgen aus der Tierhaltung stammt, denn dort wird Colistin im Gegensatz zur Humanmedizin auch in größeren Mengen eingesetzt.Resistente Erreger können aus Ställen beispielsweise über Gülle auf Felder und so in die Umwelt gelangen. Auch Tiere wie Insekten, Vögel oder Hunde können die Keime verbreiten.
Außerdem sind Kläranlagen in Deutschland derzeit nicht darauf ausgerichtet, multiresistente Bakterien komplett herauszufiltern. Das aufbereitete Wasser wird in Bäche oder Flüsse eingeleitet. Die NDR Reporter haben auch an solchen Stellen teils gefährliche und extrem resistente Keime gefunden – etwa in dem Fluss Hase, kurz hinter dem Ausfluss des kommunalen Klärwerks von Osnabrück.
Der NDR hat mehrere Ministerien zu den Funden befragt. Das Bundesgesundheitsministerium erklärte sich für nicht zuständig und verwies auf das Bundesumweltministerium. Dies wiederum schrieb dem NDR, das Wissen zur Verbreitung von Resistenzen über die Umwelt sei „nicht ausreichend“. Es spricht sich daher für systematische Untersuchungen aus. „Handlungsbedarf besteht zum Beispiel in Badegewässern“, meint das Bundesumweltministerium. Auch eine weitergehende Abwasserreinigung sei zumindest in einigen Gebieten erforderlich. Doch für die Umsetzung verweist das Berliner Ministerium an die Bundesländer.
Zumindest in Niedersachsen schätzen die zuständigen Landesministerien das Gesundheitsrisiko allerdings als gering ein und sehen keinen besonderen Handlungsbedarf. Sie verweisen auf bestehende Vorschriften und Kontrollen. Eine Untersuchung der Gewässer auf Antibiotika-resistente Keime wird als nicht erforderlich angesehen.
Das Umweltministerium in Hannover teilte zu den Kläranlagen mit, sie erfüllten die gesetzlichen Vorgaben. Die Einführung einer zusätzlichen Reinigungsstufe sei „daher derzeit grundsätzlich nicht vorgesehen“. Das Umweltministerium hält lediglich eine Behandlung von Dünger für „zielführend“, um den Eintrag von resistenten Erregern in die Umwelt zu reduzieren. Doch dafür sei Niedersachsens Landwirtschaftsministerium zuständig. Dies wiederum hält eine solche Maßnahme nicht für gerechtfertigt.
Schätzungen zufolge sterben in Deutschland mehrere Tausend Menschen jährlich an Erkrankungen durch multiresistente Keime. Weltweit gelten Antibiotika-Resistenzen als eine der größten Gesundheitsgefahren und als Bedrohung für die gesamte moderne Medizin. In einem aktuellen Bericht warnen die Vereinten Nationen explizit vor den Risiken durch eine Verbreitung von resistenten Keimen in der Umwelt und fordern die Staaten auf, endlich zu handeln.
In Deutschland läuft derzeit ein großes Forschungsprojekt zur Verbreitung Antibiotika-resistenter Erreger durch Abwasser, finanziert vom Bundesforschungsministerium. Ergebnisse des Projekts mit dem Namen HyReKA, an dem auch die TU Dresden beteiligt ist, liegen noch nicht vor.
Mehr zu dem Thema in der Sendung „Panorama – die Reporter“ am Dienstag, 6. Februar, um 21.15 Uhr im NDR Fernsehen.
Quelle: NDR Presse und Information
Internet: www.ndr.de
Bild/er: Pixabay – Lizenz: Public Domain CC0
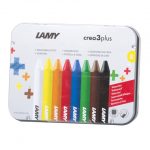 In den Lamy Crea3Plus Wachsmalstiften, wasserfest wies das Labor null Prozent Bienenwachs nach, obwohl dieses als Inhaltsstoff auf der Verpackung aufgeführt ist. Das Set (6,99 Euro/8 Stück) enthält jede Menge Problemstoffe, darunter die aromatischen Kohlenwasserstoffe MOAH und PAK.
In den Lamy Crea3Plus Wachsmalstiften, wasserfest wies das Labor null Prozent Bienenwachs nach, obwohl dieses als Inhaltsstoff auf der Verpackung aufgeführt ist. Das Set (6,99 Euro/8 Stück) enthält jede Menge Problemstoffe, darunter die aromatischen Kohlenwasserstoffe MOAH und PAK.