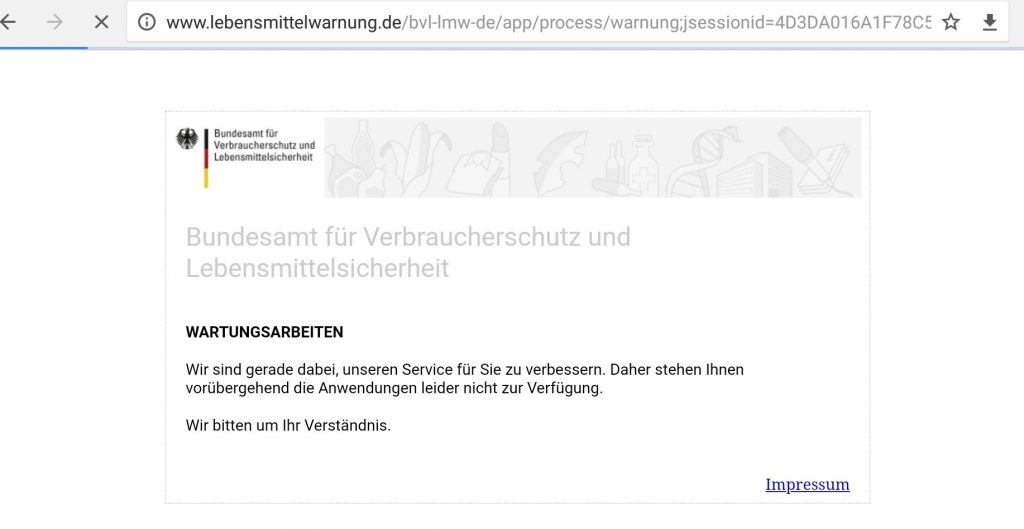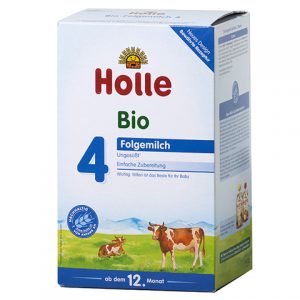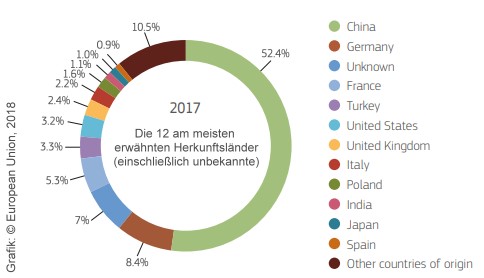Vorgeschnittenes Obst und Blattsalate können mikrobiell belastet sein
Obstbecher und in Folien verpackte Blattsalate müssen gekühlt angeboten und aufbewahrt werden
Praktisch, appetitlich und vitaminreich – aufgeschnittenes Obst und vorgeschnittene Blattsalate werden gerade im Sommer gerne für unterwegs mitgenommen. Doch vom Anbau bis zur Verpackung besteht das Risiko einer mikrobiellen Kontamination, wie das Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL) in Berlin betont. Die Untersuchungsergebnisse der Bundesländer der vergangenen Jahre zeigen, dass Enterobakterien, Schimmelpilze und Hefen vermehrt auftreten. Bei vorgeschnittenen, verpackten Blattsalaten wurden in Einzelfällen auch potentiell krankmachende Keime nachgewiesen. Verbraucher sollten daher darauf achten, dass Obst und Salate, die vorgeschnitten sind, im Handel immer gekühlt angeboten und zu Hause im Kühlschrank aufbewahrt werden.
Sowohl zerkleinertes Obst als auch zerkleinerte, in Folien verpackte Blattsalate gehören zu den leicht verderblichen Lebensmitteln. Lebensmittelunternehmer müssen daher bei diesen Produkten strenge Hygienevorschriften beachten. Ob diese eingehalten werden, überprüfen die Lebensmittelüberwachungsbehörden der Bundesländer regelmäßig. So werden im Rahmen des risikoorientierten Bundesweiten Überwachungsplanes (BÜp) und des repräsentativen Zoonosen-Monitorings Lebensmittel regelmäßig auf mikrobiologische Parameter untersucht.
Im BÜp 2016 wurden 745 Proben vorverpackten aufgeschnittenen Obstes (Obstmischungen und exotisches Obst) auf diverse Mikroorganismen untersucht. Dabei wurde nicht jede Probe auf alle Untersuchungsparameter untersucht. 80 % der Proben wurde im Handel gekühlt angeboten.
Am häufigsten konnten Schimmelpilze nachgewiesen werden – 135 von 737 Proben (18 %) enthielten Gehalte über dem DGHM-Richtwert (Empfehlungen der Deutschen Gesellschaft für Hygiene und Mikrobiologie). In 81 (11 %) bzw. 31 (4,3 %) der 713 darauf untersuchten Proben wurden die Richt- bzw. Warnwerte für Enterobakterien überschritten. Dies ist ein möglicher Hinweis darauf, dass die Prinzipien einer guten Hygienepraxis nicht eingehalten wurden. Die Anzahl an Hefen überschritt in 65 (9 %) von 738 auswertbaren Proben den DGHM-Richtwert. In fünf von 745 Proben konnte Escherichia coli nachgewiesen werden, zwei Proben davon überschritten den DGHM-Richtwert. In zwei von 700 Proben wurden die Richtwerte für koagulase-positive Staphylokokken überschritten. Salmonellen konnten in keiner der 632 ausgewerteten Obstproben nachgewiesen werden.
Keine Salmonellen in Melonen
 Ein Jahr zuvor standen ungekühlte und aufgeschnittene Wasser-, Honig-, Cantaloupe- und Netzmelonen im Fokus der Überwachungsämter. Sie wurden auf Salmonellen untersucht. Hier war das Ergebnis erfreulicher. Von den 486 untersuchten Proben waren alle mikrobiologisch unauffällig – in keiner der Proben konnte Salmonella spp. nachgewiesen werden.
Ein Jahr zuvor standen ungekühlte und aufgeschnittene Wasser-, Honig-, Cantaloupe- und Netzmelonen im Fokus der Überwachungsämter. Sie wurden auf Salmonellen untersucht. Hier war das Ergebnis erfreulicher. Von den 486 untersuchten Proben waren alle mikrobiologisch unauffällig – in keiner der Proben konnte Salmonella spp. nachgewiesen werden.
Die im Zoonosen-Monitoring des Jahres 2015 untersuchten Proben von vorgeschnittenen, verpackten Blattsalaten waren in Einzelfällen mit potentiell krankmachenden Keimen kontaminiert. In einer der 391 Proben (0,3 %) wurden Salmonellen nachgewiesen. Den gesetzlichen Anforderungen gemäß gilt vorzerkleinerter Salat, in dem Salmonellen nachgewiesen werden, als gesundheitsschädlich und muss vom Markt genommen werden. 2 % der 344 Proben von vorgeschnittenen, verpackten Blattsalaten waren mit Listeria monocytogenes kontaminiert. Allerdings wurden nur niedrige Keimgehalte festgestellt, die üblicherweise keine Gesundheitsgefahr für den Menschen darstellen.
Tipps für Verbraucher
Aufgrund der Anbaubedingungen können Obst und Salate in Kontakt mit diversen Mikroorgansimen kommen. Vorgeschnittene Salate und abgepackte Obststücke werden roh verzehrt und durchlaufen in aller Regel keinen Produktionsschritt, der geeignet ist, die Mikroorganismen abzutöten. Während das Obst durch das Aufschneiden und den damit verbundenen Kontakt mit der Schale kontaminiert werden kann, sorgen bereits kleine Schnitt- und Bruchstellen bei Salatblättern und dem dort austretenden Saft für das Wachstum verschiedener Mikroorganismen. Das häufig säurearme Fruchtfleisch der angebotenen Obstsorten und das feuchte Milieu der folienverpackten Salatmischungen fördern das Wachstum der Keime. Werden die Produkte dann noch ungekühlt gelagert, können sich die Bakterien noch schneller vermehren.
Empfehlungen
Das BVL rät daher, beim Kauf von vorgeschnittenem Obst und Salaten auf Folgendes zu achten:
Eine hohe Keimbelastung ist selten mit bloßem Auge zu erkennen. Trotzdem lohnt ein gezielter Blick, um den Frischezustand des Produktes zu erkennen. Farbverlust, braune Stellen oder viel Flüssigkeit weisen auf eine mangelnde Frische hin. Ebenso kritisch ist eine gewölbte Verpackung, da die gebildeten Gase Zeichen der einsetzenden Gärung sind.
Achten Sie beim Kauf darauf, dass vorgeschnittenes Obst und Salate im Kühlregal liegen, und halten sie das Verbrauchs- bzw. Mindesthaltbarkeitsdatum ein.
Verzehren Sie das aufgeschnittene Obst bzw. den bereits zerkleinerten Salat rasch oder bewahren Sie es im Kühlschrank oder einer Kühltasche auf. Entsorgen Sie Produkte, die längere Zeit einer hohen Temperatur ausgesetzt waren, also beispielsweise ungekühlt gelagert oder gar dem direkten Sonnenlicht ausgesetzt wurden.
Hintergrundinformation
Das Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL) ist eine eigenständige Bundesoberbehörde im Geschäftsbereich des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft. Das BVL ist für die Zulassung von Pflanzenschutzmitteln, Tierarzneimitteln und gentechnisch veränderten Organismen in Deutschland zuständig. Im Bereich der Lebensmittel- und Futtermittelsicherheit übernimmt es umfassende Managementaufgaben und koordiniert auf verschiedenen Ebenen die Zusammenarbeit zwischen dem Bund, den Bundesländern und der Europäischen Union. In der Rubrik „Lebensmittel im Blickpunkt“ stellt das BVL regelmäßig Informationen zu bestimmten Lebensmitteln zusammen.
Quelle: Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL)
Internet: https://www.bvl.bund.de
Immer auf dem Laufenden mit unseren App’s zu Produktrückrufen und Verbraucherwarnungen als kostenloser Download
 |
 |
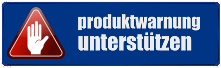 |